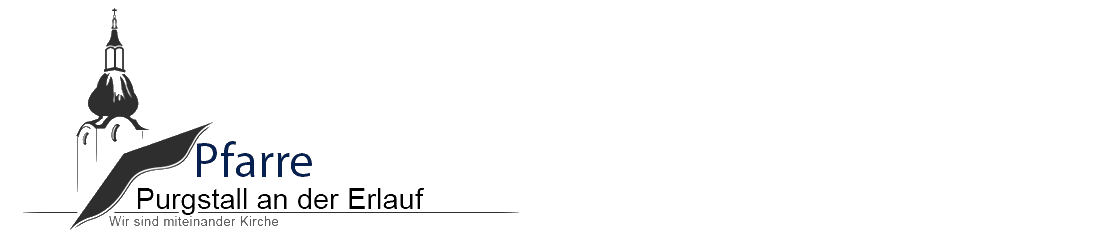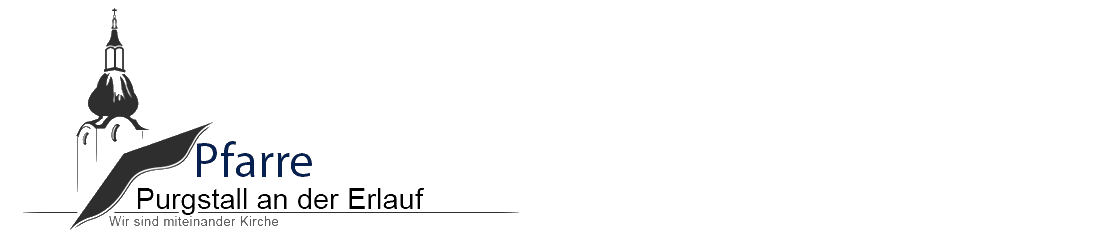Liebe Gottesdienstgemeinschaft,
An den beiden wichtigsten Hochfesten unseres Glaubens – Ostern und Weihnachten, und auch bei vielen anderen liturgischen Anlässen, hat das Licht, das Licht bringen einen zentralen Platz in unseren Feiern. Denken Sie an das Osterlicht, die Osterkerze, die Taufkerze, an die adventlichen Kerzen, das Licht von Bethlehem, an das ewige Licht in unserer Kirche, an die Gedenkkerzen für die Verstorbenen im Rückraum unseres Gotteshauses – und viele, viele Lichtsymbole mehr! Ich bin mir ziemlich sicher: Es gibt keine wichtigere Symbolik für unseren Glauben als das Licht.
In dieser Meinung bestätigt mich das heutige Weihnachtsevangelium ganz nachdrücklich, indem der Evangelist Johannes gleich zu Beginn seines berühmten Prologes eine ganze Passage dem Licht, dem Lichtbringer Jesus Christus widmet. Ich wiederhole: „In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.“ Und weiter heißt es: „Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.“ Allein diese wenigen Sätze zeugen davon, welche Kraft, welche Leuchtkraft von Jesus ausgehen will, auf welche Kraft wir in unserem Glauben bauen können!
Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ich bitte Euch nun, Euren Blick auf unser schönes Weihnachtsbild am Hochaltar zu richten. Der uns unbekannte Maler hat diesen Satz vom Licht in der Finsternis bildlich wunderbar umgesetzt, indem er aus einer rundum dunklen Umgebung die Krippenszene, das Jesuskind in hellem Licht erstrahlen lässt. Dieser - besonders in der Barockzeit angewandte - Malstil soll das Wesentliche in einem Bild in deutlicher Weise hervorheben. In unserem Bild hebt der Künstler aus der dunklen Stallumgebung diesen lichtbringenden Jesus heraus.
Und das ist nicht nur Symbolik, das ist auch der Lebensrealität der Menschen geschuldet, der damaligen Bewohner von Judäa ebenso wie unserer heutigen Erdbevölkerung. Sind doch die Menschen damals wie heute vom Dunkel umzingelt, immer wieder bedroht durch dunkle, furchtbare, ja katastrophale Ereignisse, die machtgierige, brutale und über Leichen gehende Menschen hervorrufen, die über uns Menschen hereinbrechen wie Naturkatastrophen.
Damals vor 2000 Jahren waren das die römischen Eroberer und Besatzer, die eigene jüdische Machtschicht, wie zum Beispiel Herodes, der hunderte Buben im Land ermorden ließ, heute sind es die Präsidenten der Supermächte, die mit ihren Eroberungsgelüsten und Machtdemonstrationen abertausende in den Tod und die Verzweiflung treiben. Gerade im Heiligen Land spiegeln sich Zeichen der Zerstörung und des Todes wider, die wir aus biblischen Schilderungen zur Zeit Jesu gut kennen.
Nicht zu vergessen, die kleinen und größeren dunklen Ecken, die wir in jedem Lebensbereich ausmachen können, unsere eigenen, die der Nachbarn, die in unserer Gemeinde. Auch die tragen zum Dunklen in unserer Welt bei, wie wir das eben als Sinnbild in dem Kunstwerk an unserem Altar wahrnehmen können.
Doch da ist eben auch das Zentrum des Bildes, das lichtdurchflutete, das lichtbringende Jesuskind. Auch das ist Sinnbild, ja überwältigende Symbolik, die da drinnen steckt. Das lichte, das erhellende, das wärmende, das göttliche lässt sich von keiner Finsternis verdrängen, im Gegenteil, das Licht kann die Dunkelheit wandeln und das Gute, es kann das Helle, das Heile, den Heiland hervorbringen.
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kann Böses in Gutes wandeln, kann Hass in Versöhnung wandeln, kann Verletzung in Heilung wandeln, kann Krankheit in Gesundheit wandeln, kann Krieg in Frieden wandeln, kann Sterbliches in ewiges Leben bei Gott wandeln. Insofern ist jede Wandlung in unseren Messfeiern auch eine Lichtfeier.
Ich spreche hier nicht nur von Lichtsymbolik, sondern von handfesten Tatsachen: Würden nicht abertausende Menschen, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, täglich, stündlich, minütlich billionenfach über die ganze Erde verteilen, hätten wir eine Dunkelheit auf dieser Welt, die sich niemand vorstellen mag, eine Sonnenfinsternis der Menschlichkeit, die alles Leben auf dieser Erde vernichten würde.
Aber da sind wir mit unseren kleinen Lichtern davor: Da wird geholfen, wenn Katastrophen über Menschen hereinbrechen, Rettung, Feuerwehr, Zivilschutz, private Hilfe, da wird Versöhnung versucht, gefördert, da werden Menschen geheilt durch medizinische Eingriffe, durch psychologische Unterstützung, da wird Streit geschlichtet durch Verhandlungen und Gespräche, da werden Kinder gestärkt und wertschätzend erzogen, da gibt es für Trauernde seelsorglichen Zuspruch, da gehen Menschen zu den Ärmsten der Armen, um ihnen eine Spur von Menschenwürde zu ermöglichen, da versöhnen sich streitende Ehepaare immer und immer wieder und so weiter und so fort…
Es weihnachtet sehr auf unserer Welt und zwar ununterbrochen. Täte es das nicht, die Dunkelheit würde uns umfassen. Das ist der Kern der weihnachtlichen Botschaft: Dass wir das Licht, das uns erleuchtet und lebendig macht, zur Welt bringen. Damit können wir die Dunkelheit zurückdrängen und in Schach halten.
„Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren.“ Ich möchte diesen durchaus sehr bekannten Satz des deutschen Dichters Angelus Silesius, mit bürgerlichen Namen Johannes Scheffler, in eine positive Richtung drehen und umdeuten: „Wird Christus nicht nur in Bethlehem geboren, sondern tausende Male in uns, dann ist die Welt ganz sicher nicht verloren.“
Diese Sehnsucht nach dem Guten, dem Hellen, dem Wärmenden, dem Menschlichen, dem Heilenden, dem Heiligen, das drücken wir doch zu Weihnachten mit unseren vielen Geschenken aus.
Ein Geschenk, dass sich jeder immer wieder über das ganze Jahr machen kann, ist, bewusst wahrzunehmen und zu sehen, wie in den Menschen, denen du begegnest, immer wieder göttliches Licht aufleuchtet, wie durch Menschen die Welt lichter gemacht wird.
Und es ist so wie im Stall von Bethlehem: Am besten siehst du die Leuchtkraft Gottes in den einfachen Leuten, die um dich sind.
Du kannst dafür ein Sensorium stärken und entwickeln. Du könntest ein Lichtentdecker werden und dadurch selbst licht werden. (Werde Licht!)
So könnten wir alle nachhaltiger weihnachtlich feiern und damit uns und unseren Mitmenschen immer wieder Gutes tun, uns gegenseitig stärken, ermutigen und aufbauen. An so ein Christkind können doch auch Erwachsene glauben, oder nicht?
Diakon Franz Hofmarcher